

Echtes Johanniskraut
Sammeln soll man diese Sonnenpflanze am besten zwischen dem 21. Juni und dem 15. August, also zwischen Sommersonnenwende und der Kräuterweihe, die
anlässlich des Festes Maria Aufnahme in den Himmel stattfindet.
1
Kräuter aus dem Kloster
In diese
Zeitspanne fällt
mit dem
24. Juni auch
das Hochfest,
das der Pflanze
ihren Namen
gab: die Geburt
Johannes des
Täufers.
Das
Johanniskraut
wächst
vornehmlich an
Standorten, wo
es der Sonne
direkt
ausgesetzt ist:
auf
Trockenwiesen,
an Weg- und
Waldrändern.
Bereits der
Anblick der
leuchtend
gelben Blüten
mit ihren langen, an Sonnenstrahlen erinnernden Staubgefässen ist
eine Freude. Und so wirkt die Pflanze auch als Tee:
Ein Teelöffel Kraut (Blätter und Blüten)
übergossen mit 250 ml heissem Wasser – fünf
Minuten ziehen lassen – hellt die Stimmung auf.
Hyper – über, eikon – Bild: Hypericum hebt über
die dunklen, depressiven Seelenbilder hinaus.
Ein Versuch lohnt sich auch bei
Spannungskopfweh, Erschöpfungszuständen und
Schlaflosigkeit. Wenn man Blüten und Blätter
zerreibt, werden die Finger rot. Dieses wertvolle
Öl beschleunigt äusserlich aufgetragen die
Heilung von Wunden und Narben und hilft beispielsweise
gegen die Infektion mit Herpesviren. Perforatum
– durchlöchert – bezieht sich auf die dunklen Öldrüsen an
Blüten und Blättern. Wer allerdings über längere
Zeit Johanniskraut anwendet, soll die Sonne meiden. Das wäre
zu viel des Guten. Öl und Tee tragen die Kraft der
Sonne nämlich bereits in sich.
Text: Alexandra Dosch, Theologin
Frischkonserve
Der Mann, der jedes Genre sprengt
Vor gut hundert Jahren kam im Vorraum eines Verlags Father Brown zur Welt. Gilbert Keith Chesterton hatte spontan hingeworfen, was Bertolt Brecht später eine
«Gipfelleistung der literarischen Psychologie» nannte.
Chesterton bietet alles, was der Porträtist liebt. Es gibt von ihm herrliche Anekdoten zu erzählen: 1901, am Morgen seiner Heirat kaufte sich der Hüne eine Pistole samt
Munition, um damit seine Braut Frances zu beschützen. Und Jahre später rückte ihm die Sittenpolizei auf den Leib, weil er an einer Hotel-Rezeption dermassen unverfroren
mit eben dieser Frances schäkerte, dass niemand glauben mochte, es handle sich hier um ein rechtmässig angetrautes Paar.
Chesterton liefert provokative Geistesblitze in rauen Mengen: «Der Erfolg der Ehe kommt nach dem Scheitern der Flitterwochen.» oder «Ich habe ‹Die Schatzinsel› von
Stevenson zwanzigmal gelesen; trotzdem kenne ich sie.» und dann wieder «Ein Abgrund klafft zwischen denen, die einen Menschen genügend respektieren, um ihn zu
bestrafen, und jenen, die ihn genügend verachten, um ihm zu vergeben.»
Auch an Lobeshymnen anderer Literaten mangelt es nicht. Denn obgleich Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936) ein begnadeter Polemiker war, so haben sie ihn doch
allesamt verehrt, selbst wenn sie seine Weltsicht nicht teilen mochten. Ob Jorge Luis Borges, George Bernard Shaw, André Maurois, Kurt Tucholsky und auch Franz Kafka, der
einmal bekannte: «Er ist so lustig, dass man fast glauben könnte, er habe Gott gefunden.»
All diesen Vorzügen zum Trotz, ist Chesterton bei uns ein notorischer Geheimtipp geblieben. Schuld daran ist vor allem das katholische Milieu des vergangenen Jahrhunderts,
das ihn für sich gepachtet und zum katholischen Apologeten gestempelt hat. Wenn der tatsächlich leidenschaftliche, aber gerade deshalb von keiner Dogmatik zu zähmende
Katholik heute gepriesen wird, dann vornehmlich von Agnostikern und Atheisten, von papistisch vollkommen unverdächtigen Intellektuellen wie Hans Magnus Enzensberger,
Slavoj Zizek oder Michael Maar. Sie schätzen die Sprengkraft dieses grossen Geistes genauso wie es bereits die grosse «Crime Lady» Dorothy L. Sayers getan hat: «Wie eine
wohltuende Bombe zertrümmerte er in der Kirche eine Menge Glasgemälde aus einer dürftigen Zeit und liess frischen Wind herein.»
Maschinerie der Vergebung
Geschadet hat der Reputation Chestertons im deutschsprachigen Raum aber auch der Erfolg seiner Detektivgeschichten. Erstens brachte man Heinz Rühmann als «Pater
Brown» und dann sogar als «Kardinal Brown» auf die Leinwand, eine Mischung aus Don Camillo, Feuerzangenbowle und Bruchpilot Quax, die allenfalls noch Spurenelemente
aus Chestertons Erzählungen aufwies.
Und zweitens wurden die Erzählungen erst sehr spät, nämlich von 1990 bis 1993, in Übersetzungen herausgebracht, die dem Original würdig waren. Hanswilhelm Haefs und
dem Haffmans-Verlag ist es zu verdanken, dass Chestertons Sprachkunst nun auch im Deutschen funkelt. Diese Übersetzungen sind als Insel-Taschenbücher erhältlich und
werden derzeit sukzessive als Hörbücher herausgebracht.
Dass Detektivgeschichten den literarischen Ruhm gefährden können, wusste Chesterton allerdings schon, bevor er damit begonnen hatte, sie zu schreiben. 1901 erschien
«The Defendant», in dem er neben allerlei anderem Verachteten auch die Detektivgeschichte verteidigte. Erst zehn Jahre später begann Chesterton dann mit «The Blue Cross»
selbst solchen «Schund» zu schreiben – weil einer Zeitschrift gerade danach war.
So wurde 1910 Father Brown geboren, der unscheinbare Dorfpfarrer, über den Chesterton in seiner Autobiografie schrieb: «Father Browns Besonderheit war, dass er keine
hatte. Sein Zweck war es, zwecklos zu erscheinen; und man könnte sagen, dass seine auffallendste Eigenschaft die war, nicht aufzufallen. Sein gewöhnliches Aussehen sollte
mit seiner unvermuteten Wachsamkeit und Intelligenz kontrastieren; und deshalb machte ich aus ihm eine schäbige und formlose Erscheinung, mit einem runden,
ausdruckslosen Gesicht, mit unbeholfenen Manieren usw.» Dieser unscheinbare Gelegenheitsdetektiv löste in seiner langen Karriere bis 1936 fünfzig Fälle.
Obwohl Chesterton mit Father Brown bewusst eine Leerstelle geschaffen hatte, liess er sich dafür doch von einem realen Vorbild inspirieren. Dieses war sein Freund John
O’Connor, ein katholischer Pfarrer aus Yorkshire, der ebenso unscheinbar wie klug war. An ihm entdeckte Chesterton, dass ausgerechnet ein scheinbar weltfremder Seelsorger
in die tiefsten menschlichen Abgründe blicken konnte. In «Der Hammer Gottes» wird Father Brown, nachdem er den Fall gelöst hat, gefragt: «Wie können Sie all das wissen?
Sind Sie ein Teufel?» Darauf antwortet er: «Ich bin ein Mensch und habe daher alle Teufel in meinem Herzen.»
Falls wir nun erwarten, nur weil Brown Priester sei, löse er seine Fälle mittels göttlicher Eingebung, dann hat uns Chesterton einmal mehr beim naiven Vorurteil ertappt. Auch
wenn Brown kein Experte in Sachen Zigaretten-Asche und Wachs-Sorten ist, so löst er seine Fälle dennoch mit genauso scharfem Verstand wie Sherlock Holmes. Ronald Knox,
der selbst Priester und erfolgreicher Krimi-Autor war, meinte dazu: «Das wahre Geheimnis von Father Brown ist, dass nichts Mystisches an ihm ist.» In Wahrheit ist Brown viel
rationaler als all jene, die von ihm erbauliches Geschwafel erwarten.
Auch den Gefallen, ein Moralist zu sein, tut Brown seiner ignoranten Leserschaft nicht. Weshalb nicht, das erklärt Chesterton am besten gleich selbst: «Die Kirche ist die
einzige Einrichtung, die jemals systematisch versucht hat, Verbrechen zu verfolgen und aufzudecken, nicht um sie zu rächen, sondern um sie zu vergeben.»
Der andere Kafka
Einige der scharfsinnigsten Beobachtungen zu Father Brown verdanken wir Jose Luis Borges. Unter anderem hat er erkannt, weshalb sich ausgerechnet Kafka von
Chesterton so angezogen fühlte: «Die Behauptung klingt erstaunlich, dass ein so gütiger und umgänglicher Mensch wie G. K. Chesterton auch ein in sich
gekehrter Mensch war, der das Grauen der Dinge spürte. Aber sein Werk bezeugt es uns gegen seinen Willen. So vergleicht er die Gewächse eines Gartens mit
angeketteten Tieren, den Marmor mit erstarrtem Mondlicht, das Gold mit zu Eis gewordenen Flammen und die Nacht mit einer Wolke, die grösser ist als die Welt,
ein Ungeheuer, das aus Augen besteht. Er hätte Kafka oder Poe sein können, aber er entschied sich tapfer für das Glück oder tat so, als ob er es gefunden
hätte.»
Bibel ,,Alte Testament" ,,Neue Testament"

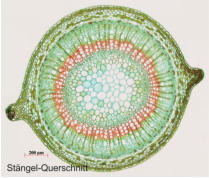


Sonntagsgedanken
*Das Leid mit der Kirche*






