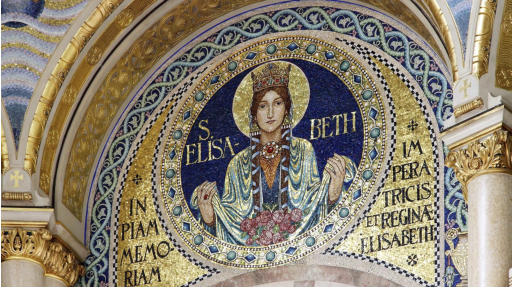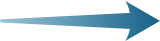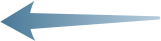«Thomas, der Apostel»
Zwilling,
Zweifler,
Indienmissionar – Thomas hat unter den Aposteln ein
eigenständiges Profil. Sein Gedenktag wird in neun
christlichen Kirchen gefeiert, in unserer am 3. Juli.
Jesus könnte Thomas vielleicht Ta’am gerufen haben. Das
ist die Wurzel des Namens Thomas, aus der aramäischen
Sprache, die auch Jesus gesprochen hat. Ta’am heisst
Zwilling. Rund 300 Jahre nachdem Jesus und Thomas
miteinander unterwegs waren, wissen die sogenannten Tho-
masakten zu erzählen, die beiden könnten tatsächlich
Zwillinge gewesen sein. Zumindest im übertragenen Sinn:
Als ein «Zwilling» Christi soll Thomas Wunder vollbracht und
Menschen bekehrt haben. Und das in
Indien.
Tatsache ist, dass sich heute sieben Kirchen im Osten
Indiens «Thomas-
christen» nennen. Sie sehen im Apostel Thomas ihren
Gründervater, der für seinen Glauben dort auch das
Martyrium erlitten haben soll. Berühmt geworden ist Thomas
für eine Geschichte, die in der Bibel überliefert ist. «Wenn
ich meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht»
ist jener Satz, der Thomas in Verruf gebracht hat, an der
Auferstehung Jesu zu zweifeln. Jesus dagegen lässt sich
herausfordern. Ein Privileg, das einem «Zwilling» offenbar
zusteht.
Text: Veronika Jehle

Maria, die Apostelin
Sie steht für Gleichberechtigung. Ihren Gedenktag am 22. Juli hat
Papst
Franziskus zum
Fest erhoben
und Maria
Magdalena
damit den
Aposteln
gleichgestellt.
Für mich
persönlich
gehört die
Szene zu den
berührendsten
Momenten im
Neuen
Testament:
Jesus steht
ihr
gegenüber und
sagt nur:
«Maria!» Und
sie, die
ihn nicht
erkannt hat
– die ihn
auch nicht erkennen konnte,immerhin war er doch
gestorben –, erkennt am Klang ihres Namens den
Ersehnten in ihm. Intimität und Unschuld sprechen
so ruhig und innig aus diesem kurzen Dialog.
Es ist der Moment, der mein Sinnbild für
Gleichberechtigung ist: Jesus und Maria
Magdalena, Mann und Frau erkennen einander. Auf
Augenhöhe. Und anerkennen einander. In aller
Unterschiedlichkeit. Das ist Liebe. Das ist
Nächstenliebe. Agape, ob mit oder ohne Eros.
Natürlich ist gerade sie die erste Zeugin der
Auferstehung. Natürlich ist gerade sie eine von
jenen, die unter dem Kreuz ausharren. Natürlich
ist gerade sie Apostelin und geht mit Jesus
gemeinsame Wege. Natürlich lässt Jesus gerade sie
nahe an sich heran. Nicht weil sie eine Frau ist,
sondern weil sie bereit ist. Vielleicht ist sie
derart bereit, weil sie eine Frau ist. Nahe bei
Jesus ist, wer nahe bei Jesus ist. Unabhängig vom
Geschlecht.
Veronika Jehle

Maria Regina
Maria, die Mutter, hat einen Ehrentitel: Regina, lateinisch
für Königin. Das Fest «Maria, Königin des Himmels » begeht
unsere Kirche am 22. August, acht Tage nach Himmelfahrt.
Ich beobachte die Kinder einer Freundin beim Spielen. Ein
Junge und ein Mädchen, beide im Kindergartenalter. Sie
spielen Familie. Das
Mädchen steckt ein
Kissen unter ihr Shirt,
sie ist schwanger.
Stolz trägt sie den
grossen Bauch vor
sich her. Bald wird das
Baby auf die Welt
kommen.
Während mir die Freundin
erzählt, wie es
ihr geht, wie sich so
manches verändert
hat, seit die Kinder da
sind, wie müde sie
ist, wie sie sich nach
Ruhe sehnt und
nach einem Moment nur
für sich allein –
während wir also
plaudern, haben
die Kinder ein neues
Spiel entdeckt.
Sie setzen sich
gegenseitig Kronen
auf, steigen feierlich
aufs Sofa und
nehmen Platz auf dessen
Lehne.
Ich gehe zu den beiden
und frage, wer sie
denn wohl seien? «Ich
bin die Königin
von diesem Land», sagt
sie sehr ernst.
«Und was macht die
Königin?», frage
ich zurück. Einen Moment
lang schaut sie
mich mit grossen Augen an und weiss nichts zu sagen, dann
lacht sie, wirft die Krone vom Kopf und springt weg. Ich
muss an die Grossen der Welt denken. Was wissen sie schon,
was sie tun? Und ich verstehe die Sehnsucht: nach einer
ewigen Mutter, nach einer wirklichen Königin.
Text:Veronika Jehle

Mutig nach vorne schauen
Stiftskirche in Neustadt an der Weintraße
mit Pfarrer
Michael Landgraf und
Pfarrerin Dr.
Nicole Schatull
Wie kriege
ich meine Zukunft
gebacken?“
fragen sich
Jugendliche
zu Beginn des neuen
Schuljahrs.
Für ihren
Traumberuf
brauchen sie gute
Zensuren. Das
macht Druck.
Andere
möchten nach der
Schulzeit
gern auf andere
Kontinente
reisen, wissen aber
nicht, ob sie
sich das zutrauen
können. Wie ermutigend in solchen Zeiten der Ungewissheit und
Neuorientierung der Glaube an einen persönlichen Gott ist,

Kirchenjahr
Enthauptung
Es ist ein
makaberer Anlass, an den
am 29. August
gedacht wird: Johannes der
Täufer wurde geköpft.
Die Geschichte aus dem
Markus-Evangelium
liest sich wie ein Krimi.Krimis
lesen sich gut, wenn
sie rea-listisch sind, komplex,
verwickelt und
verworren, wie das Leben
selbst. Ein Feuerwerk
der Emotionen, die ab-
gleiten ins Böse,
abgründig und er-
schreckend. Die Verse
14 bis 29 aus dem sechsten
Kapitel des Evange-
liums von Markus lassen da
nichts vermissen. Sie erzählen, wie Eifersucht und Intrige einen Menschen Kopf
und Kragen kosten. Die Akteure: König Herodes und der Prophet Johannes der
Täufer, zwei Männer mit Visio-nen, allerdings mit gegensätzlichen. Dann zwei
Frauen, Herodias und Sa-lome, ihre Tochter. Die Handlung: Herodes heiratet
Herodias unrech-terweise, Johannes macht daraus kein Geheimnis. Herodias hasst
den Täu-fer dafür und für seinen Einfluss auf ihren König. Am Geburtstag des Königs
passiert es dann. Salome tanzt für Herodes, so betörend, dass dieser sagt: «Bitte
mich, um was du willst, ich will es dir geben.» Den Kopf des Propheten will
Salome. Nicht zufällig, hatte sie als anständige Tochter doch ausge-rechnet ihre
Mutter gefragt, was sie sich wünschen solle. Eifersucht, Int-rige, Mord niemand soll
mehr sa-gen, die Bibel überliefere keine rea-listischen Geschichten.
Veronika Jehle

Spiritualität ganz alltäglich
Gipfelschnaps trinken
Ich liebe die Berge und das Wandern. In diesen
Sommerferien habe ich mir einen lange gehegten Touren-Traum
erfüllt. Nach vielen Jahren war ich wieder einmal in der
Greina-Ebene, einem magischen Ort in den Bündner
Bergen. Zusammen mit meiner Frau fuhren wir ins Val
Lumnezia, von Chur mit der Rhätischen Bahn und per
Postauto auf 1560 Meter zum Ausgangspunkt nach
Vrin. Nach dreistündigem Aufstieg erreichten meine
Frau und ich den Pass Diesrut auf 2428 Meter, wo
sich ein grandioser Ausblick auf die Greina-Ebene
eröffnete, die auf Romanisch «Plaun la Greina»
genannt wird.
Die Greina ist eine der schönsten und grössten
Hochebenen der Schweiz. Die herrliche,
unberührte Naturlandschaft wurde in den
Jahren 1948 und 1949 sowie 1985 bekannt, als
in der Greina ein Wasserkraftwerk mit
Stausee gebaut werden sollte. Die Greina-
Ebene gehört zum Quellgebiet des Rheins
und dessen Wasser sollte auf der Alpensüdseite
turbiniert werden. Landesweite Proteste
führten dazu, dass das Projekt zurückgezogen
wurde. Seitdem ist die Greina als Schutzzone
ins Bundesinventar der Landschaften und
Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung
aufgenommen, denn sie birgt ein Hochmoor mit
einer paradiesischen Vielfalt seltener Gräser
und Pflanzen.
Nach sechs Stunden Wanderung kommen wir
also zur Motterascio-Hütte des SAC und
übernachten dort. Höhepunkt unserer
Wanderung sollte am nächsten Morgen die
Besteigung des 3149 Meter hohen Piz Terri
werden. Nach drei Stunden erreichen wir den
Terri-Gipfel und geniessen am Gipfelkreuz die
gigantische Aussicht in die Bündner und Tessiner
Alpen. Eine Inschrift erinnert daran, dass der
Piz Terri erstmals im Jahr 1801 von Pater Placidus a
Spescha vom Kloster Disentis bestiegen wurde.
Aus Freude und Erleichterung über den Aufstieg
begehen wir am Gipfel ein schönes Ritual, das ich schon
von meinem Vater gelernt habe: Wir berühren das
Gipfelkreuz, geben uns einen Gipfelkuss und sprechen still ein
Vaterunser. Dann holen wir den Gipfelschnaps aus dem Rucksack.
Freilich warnen Gesundheitsapostel immer wieder davor, weil
Bergtouren einen klaren Kopf verlangen. Für einen Moment ignorieren wir all diese Ratschläge und geniessen einen Schluck Edelbrand, hier oben
zwischen Himmel und Erde. Wir danken Gott für das Wunder der Natur – und sind uns ziemlich sicher, dass Pater Placidus damals auch einen
Gipfelschnaps im Gepäck hatte.
Text: Christian Cebulj, Rektor der Theologischen Hochschule Chur

Die Würde des Menschen in der Pflege ist mir nach wie vor ein grosses Anliegen.
Wofür stehen Sie ein?
Pflegende sollen nicht Tätigkeiten abarbeiten müssen, sondern für den kranken Menschen da sein. Die innere Präsenz hilft,
Prioritäten zu setzen, um nicht alles, aber das Wichtige zu tun.
Die Politik und die Gesellschaft müssen Rahmenbedingungen schaffen, damit das möglich ist.
Wie verhält sich Ihr Ordensleben, Ihr Glaube, zu Ihrem Engagement?
Ich kann das nicht trennen. Ich bin ich, in meinem Leben im Kloster genauso wie in der Bildungsarbeit. Meine
Ordensgemeinschaft gibt eine Lebens- und Gebetsstruktur. Wenn ich vor schwierigen Situationen stehe, merke ich, wie Gott
mich hält.

Franziskus von Assisi
«Il Cantico di Frate Sole» heisst das wunderbare Lied des
Italieners Francesco, «Der Gesang von Bruder Sonne». Ein
poetischer Beitrag zur Klimadebatte.
«Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein ist das Lob, die Herrlichkeit
und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.» So beginnt sein Gesang,
der Lob-gesang des Franziskus, geschrieben im 13. Jahrhundert.
Sonne und Mond werden darin zu seinen Geschwistern, zusammen mit
allem, was ist. Als wäre der Mensch einzig und alleine auf dieser
Welt, zu staunen, zu beob-achten und sich zu freuen, singt er Gott und
allem Lebendigen ein Lied. «Gelobt seist du, mein Herr, für
unsere Schwester Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfäl-
tige Früchte hervorbringt, mit bunten Blumen und Kräutern.»
Franziskus weiss, dass er alles Lebensnotwen-dige geschenkt bekommt.
Nehmen und besitzen wäre Zerstörung. Ist das gemeint, wenn der
Heilige weiter singt «Wehe jenen, die in töd-licher Sünde sterben»?
Franziskus hatte den prunkvollen Mantel seines Vaters eingetauscht
gegen eine ein-fache braune Kutte, er lebte mit der Natur und fand seinen
persönlichen Einklang mit ihr. «Selig, die Gott finden wird in
seinem heiligsten Willen.»
von Veronika Jehle
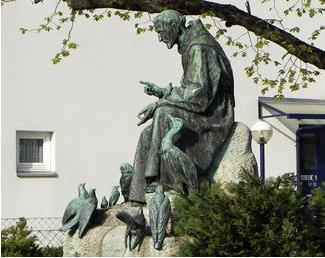
Antonius Maria
Claret
Kennen Sie diesen
Heiligen?
Sein Gedenktag wird
in der
katholischen
Tradition am
24. Oktober begangen
– sein Leben
hat Auswirkungen
bis heute,
«Claretiner» werden sie genannt, jene Männer, die sich für andere
einsetzen und sich dabei in der Nachfolge des heiligen Antonius Maria
Claret sehen. Der Spanier Claret begann mit fünf anderen im Jahr 1849,
heute sind es in seinem Orden rund 3000 in über sechzig Ländern. Zwei
davon leben und arbeiten in
Zürich. Sie feiern Messen und springen ein, wo Priester gebraucht werden, sie spenden Sakramente und besuchen Kranke im Spital, sie sammeln Spenden für die
Aufgaben ihrer Kollegen
rund um die Welt. Auch «Claretinerinnen» gehen auf den Gründer zurück. Antonius Maria Claret muss das an sich gehabt haben, was viele zu Heiligen macht: Er hat
einige konkret
angesprochen, er hat verstanden, sie zu begeistern. Er hatte eine Vision, was zu tun ist, und hat begonnen, es zu tun. Begeistert war er von Jesus Christus und von der
katholischen Weise, ihm zu
folgen.
Aus dem Sohn eines Webers
wurde so der Bischof von Santiago de Cuba und später der Beichtvater der spanischen Königin Isabella II. Karriere auf katholisch. Kurz vor seinem Tod 1870 hat er
sich am Ersten Vatikanischen Konzil für die Unfehlbarkeit des Papstes eingesetzt.
von Veronika Jehle
Im Advent schmerzt die Wunde besonders
Advent und vor allem Weihnachten wird von vielen Singles als schmerzhaft erlebt. Die Frage, mit wem oder wie ich feiern soll, liegt in der Luft. Viele bleiben für sich und spüren am Festtag der Liebe die schmerzhafte Seite der
Einsamkeit besonders stark. Die Wunde, die viele Singles mit ihrer Lebensform empfin-den, kann an Weihnachten besonders schmerzen.Die Gruppe dieser Menschen ist über alle Alter verteilt und betrifft mehrere
Lebensstände gleichzeitig: Verwitwete, Geschiedene, Partnersuchende, Allein-Gebliebene und solche, die sich für die-se Lebensform entschieden haben.
Das Büchlein von Hildegard Aepli «Alles beginnt mit der Sehnsucht. Impulse für Singles im Advent» kann gratis bezogen werden bei Übernahme der Portokosten. Interessierte melden sich bei: emanuela.zaccari@bistum-stgallen.ch
Der Allein-Stand betrifft zudem uns alle.Denn auch innerhalb einer Partner-schaft geht es darum, allein stehen zu können. Und letztendlich stehen wir Menschen am Lebensabend alleine vor Gott. Ich allein bekam mein Leben und
ich allein gebe es sozusagen wieder Gott zurück. Gerade die manchmal schwierige Advents- und Weihnachts-zeit kann uns helfen, dieses in uns sel-ber und in Gott «Verwurzelt sein» zu stärken und zu fördern.H

Elisabeth von Thüringen
Warum werden reiche Menschen heilig, bloss weil sie teilen? Diese Frage stellt mir das Leben meiner zweiten Namenspatronin, deren
Gedenktag wir am 19. November feiern.
Elisabeth wird als Frau beschrieben, die mit
allem gesegnet war: edle Abstammung, vielversprechende Zukunft
durch Heirat, solider Wohlstand, gut gebildet,
und schön, selbstverständlich. Ihr Leben fällt ins 13.
Jahrhundert, eine Zeit der Burgen und Landgrafen,
der Kriege um Gottes Willen und einer wundersam tiefen
Frömmigkeit.
Elisabeth aber wächst über den Luxus hinaus:
Weder behält sie ihre Güter für sich, noch begnügt sie sich
mit einer Frömmigkeit der wohlklingenden Worte.
Sie pflegt Kranke, bringt Brot von ihrer Burg zu den Leuten
hinunter, später wird sie ein Spital gründen.
Bemerkenswert.
Schon Jesus wusste, wie schwer es gerade für die
Wohlhabenden ist, diese sogenannte Freiheit der Kinder Gottes
zu erlangen. Dahinter steckt die eigenartige
Logik der Realität: Wer mehr hat, teilt weniger leicht. Und so
ist wohl eine Antwort auf die Frage vom Anfang:
Ob nun reich oder arm – das Teilen der eigenen Gaben bleibt
der Schlüssel zur Heiligkeit, und zwar für alle.
Interessant ist, dass es eine Parallele gibt
zwischen Elisabeth und Siddhartha Gautama, dem Buddha. Beide
brechen aus, um unter den
Armen sich selbst und das Leben zu finden.
Text: Veronika Elisabeth Jehle