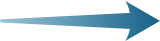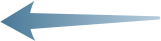Maria Regina
Maria, die Mutter, hat einen Ehrentitel: Regina, lateinisch
für Königin. Das Fest «Maria, Königin des Himmels » begeht
unsere Kirche am 22. August, acht Tage nach Himmelfahrt.
Ich beobachte die Kinder einer Freundin beim Spielen. Ein
Junge und ein Mädchen, beide im Kindergartenalter. Sie
spielen Familie. Das
Mädchen steckt ein
Kissen unter ihr Shirt,
sie ist schwanger.
Stolz trägt sie den
grossen Bauch vor
sich her. Bald wird das
Baby auf die Welt
kommen.
Während mir die Freundin
erzählt, wie es
ihr geht, wie sich so
manches verändert
hat, seit die Kinder da
sind, wie müde sie
ist, wie sie sich nach
Ruhe sehnt und
nach einem Moment nur
für sich allein –
während wir also
plaudern, haben
die Kinder ein neues
Spiel entdeckt.
Sie setzen sich
gegenseitig Kronen
auf, steigen feierlich
aufs Sofa und
nehmen Platz auf dessen
Lehne.
Ich gehe zu den beiden
und frage, wer sie
denn wohl seien? «Ich
bin die Königin
von diesem Land», sagt
sie sehr ernst.
«Und was macht die
Königin?», frage
ich zurück. Einen Moment
lang schaut sie
mich mit grossen Augen an und weiss nichts zu sagen, dann
lacht sie, wirft die Krone vom Kopf und springt weg. Ich
muss an die Grossen der Welt denken. Was wissen sie schon,
was sie tun? Und ich verstehe die Sehnsucht: nach einer
ewigen Mutter, nach einer wirklichen Königin.
Text:Veronika Jehle

Mutig nach vorne schauen
Stiftskirche in Neustadt an der Weintraße
mit Pfarrer
Michael Landgraf und
Pfarrerin Dr.
Nicole Schatull
Wie kriege
ich meine Zukunft
gebacken?“
fragen sich
Jugendliche
zu Beginn des neuen
Schuljahrs.
Für ihren
Traumberuf
brauchen sie gute
Zensuren. Das
macht Druck.
Andere
möchten nach der
Schulzeit
gern auf andere
Kontinente
reisen, wissen aber
nicht, ob sie
sich das zutrauen
können. Wie ermutigend in solchen Zeiten der Ungewissheit und
Neuorientierung der Glaube an einen persönlichen Gott ist,

Enthauptung
Es ist ein
makaberer Anlass, an den
am 29. August
gedacht wird: Johannes der
Täufer wurde geköpft.
Die Geschichte aus dem
Markus-Evangelium
liest sich wie ein Krimi.Krimis
lesen sich gut, wenn
sie rea-listisch sind, komplex,
verwickelt und
verworren, wie das Leben
selbst. Ein Feuerwerk
der Emotionen, die ab-
gleiten ins Böse,
abgründig und er-
schreckend. Die Verse
14 bis 29 aus dem sechsten
Kapitel des Evange-
liums von Markus lassen da
nichts vermissen. Sie erzählen, wie Eifersucht und Intrige einen Menschen Kopf
und Kragen kosten. Die Akteure: König Herodes und der Prophet Johannes der
Täufer, zwei Männer mit Visio-nen, allerdings mit gegensätzlichen. Dann zwei
Frauen, Herodias und Sa-lome, ihre Tochter. Die Handlung: Herodes heiratet
Herodias unrech-terweise, Johannes macht daraus kein Geheimnis. Herodias hasst
den Täu-fer dafür und für seinen Einfluss auf ihren König. Am Geburtstag des Königs
passiert es dann. Salome tanzt für Herodes, so betörend, dass dieser sagt: «Bitte
mich, um was du willst, ich will es dir geben.» Den Kopf des Propheten will
Salome. Nicht zufällig, hatte sie als anständige Tochter doch ausge-rechnet ihre
Mutter gefragt, was sie sich wünschen solle. Eifersucht, Int-rige, Mord niemand soll
mehr sa-gen, die Bibel überliefere keine rea-listischen Geschichten.
Veronika Jehle

Kirchenjahr
Spiritualität ganz alltäglich
Gipfelschnaps trinken
Ich liebe die Berge und das Wandern. In diesen
Sommerferien habe ich mir einen lange gehegten Touren-Traum
erfüllt. Nach vielen Jahren war ich wieder einmal in der
Greina-Ebene, einem magischen Ort in den Bündner
Bergen. Zusammen mit meiner Frau fuhren wir ins Val
Lumnezia, von Chur mit der Rhätischen Bahn und per
Postauto auf 1560 Meter zum Ausgangspunkt nach
Vrin. Nach dreistündigem Aufstieg erreichten meine
Frau und ich den Pass Diesrut auf 2428 Meter, wo
sich ein grandioser Ausblick auf die Greina-Ebene
eröffnete, die auf Romanisch «Plaun la Greina»
genannt wird.
Die Greina ist eine der schönsten und grössten
Hochebenen der Schweiz. Die herrliche,
unberührte Naturlandschaft wurde in den
Jahren 1948 und 1949 sowie 1985 bekannt, als
in der Greina ein Wasserkraftwerk mit
Stausee gebaut werden sollte. Die Greina-
Ebene gehört zum Quellgebiet des Rheins
und dessen Wasser sollte auf der Alpensüdseite
turbiniert werden. Landesweite Proteste
führten dazu, dass das Projekt zurückgezogen
wurde. Seitdem ist die Greina als Schutzzone
ins Bundesinventar der Landschaften und
Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung
aufgenommen, denn sie birgt ein Hochmoor mit
einer paradiesischen Vielfalt seltener Gräser
und Pflanzen.
Nach sechs Stunden Wanderung kommen wir
also zur Motterascio-Hütte des SAC und
übernachten dort. Höhepunkt unserer
Wanderung sollte am nächsten Morgen die
Besteigung des 3149 Meter hohen Piz Terri
werden. Nach drei Stunden erreichen wir den
Terri-Gipfel und geniessen am Gipfelkreuz die
gigantische Aussicht in die Bündner und Tessiner
Alpen. Eine Inschrift erinnert daran, dass der
Piz Terri erstmals im Jahr 1801 von Pater Placidus a
Spescha vom Kloster Disentis bestiegen wurde.
Aus Freude und Erleichterung über den Aufstieg
begehen wir am Gipfel ein schönes Ritual, das ich schon
von meinem Vater gelernt habe: Wir berühren das
Gipfelkreuz, geben uns einen Gipfelkuss und sprechen still ein
Vaterunser. Dann holen wir den Gipfelschnaps aus dem Rucksack.
Freilich warnen Gesundheitsapostel immer wieder davor, weil
Bergtouren einen klaren Kopf verlangen. Für einen Moment ignorieren wir all diese Ratschläge und geniessen einen Schluck Edelbrand, hier oben
zwischen Himmel und Erde. Wir danken Gott für das Wunder der Natur – und sind uns ziemlich sicher, dass Pater Placidus damals auch einen
Gipfelschnaps im Gepäck hatte.
Text: Christian Cebulj, Rektor der Theologischen Hochschule Chur

Die Würde des Menschen in der Pflege ist mir nach wie vor ein grosses Anliegen.
Wofür stehen Sie ein?
Pflegende sollen nicht Tätigkeiten abarbeiten müssen, sondern für den kranken Menschen da sein. Die innere Präsenz hilft,
Prioritäten zu setzen, um nicht alles, aber das Wichtige zu tun.
Die Politik und die Gesellschaft müssen Rahmenbedingungen schaffen, damit das möglich ist.
Wie verhält sich Ihr Ordensleben, Ihr Glaube, zu Ihrem Engagement?
Ich kann das nicht trennen. Ich bin ich, in meinem Leben im Kloster genauso wie in der Bildungsarbeit. Meine Ordensgemeinschaft
gibt eine Lebens- und Gebetsstruktur. Wenn ich vor schwierigen Situationen stehe, merke ich, wie Gott mich hält.

Niklaus von Flüe
* 1417 in Flüeli, Ortsteil von Sachseln im Kanton Obwalden in der Schweiz
† 21. März 1487 in der Ranftschlucht bei Flüeli im Kanton Obwalden in der Schweiz
Ein Mann zwischen Familie, Beruf und Berufung: Niklaus lebte diese Spannung bereits im 15. Jahrhundert. Am
25. September gedenkt sein Land gern des bedeutenden
Schweizers.Über Niklaus von Flüe sollte man Bescheid wissen.
Im Jahr 1481 hatte er der schweizerischen Eidgenossen-schaft zur
vertieften Einheit verhol-fen, indem er die Tagsatzungsherren
bewegte, nochmals zusammenzutre-ten und eine friedliche Lösung
ihrer Konflikte zu finden. Darauf beschlossen die acht Orte sogar,
Freiburg und Solothurn auf-zunehmen, was den Bund erweiterte
und ganz nebenbei die Mehrsprachig-keit in der Schweiz einleitete.
Über Niklaus von Flüe sollte man aber nicht nur aus
geschichtlichen oder politischen Gründen Bescheid wissen.
Wegweisend ist seine Art, sein eigenes Leben zu gestalten.
Begabt war er unbestritten, arbeitsam eben-falls: Bauer, Ratsherr,
Ehemann und Vater soll er gewesen sein, später dann
Einsiedler, bevor Ehrentitel wie Friedensstifter, Mystiker und
Heiliger hinzukamen.
Wie fand er den Weg durch all die Ansprüche, zwischen den
Versuchun-gen des Erfolgs und den Abgründen der Konflikte?
Tatsächlich im Gebet. Seine Mitte, seine Quelle, Kompass und
Wegweiser war für ihn das Sit-zen in der Stille. Seit jeher soll er da-für jede Nacht aufgestanden sein, be-zeugt sein
ältester Sohn.Veronika Jehle


Nikolaus, Sohn des
gemeinfreien Bauern
Heini und seiner Frau
Hemma, die 12 Hektar
Grund besaßen und
damit reiche Bauern
waren, wurde schon als
Kind mit Visionen
bedacht. Als Jugendlicher
hatte er einen
ausgeprägten Hang zur
Einsamkeit und zum
stillen Gebet. Im Alter
von 16 Jahren sah er in
einer Vision einen hohen
Turm an der Stelle im
Ranft, an der er später
seine Einsiedelei
errichtete. Berichtet wird
auch vom Besuch dreier
Männer - ähnlich dem
Besuch der drei
göttlichen Männer bei
Abraham -, die ihm
seligen Tod verhießen
und ihm ein Kreuz als
Zeichen übergaben.
Nikolaus, Sohn des gemeinfreien Bauern Heini und seiner Frau Hemma, die 12 Hektar Grund besaßen und damit reiche Bauern waren, wurde schon als Kind mit Visionen
bedacht. Als Jugendlicher hatte er einen ausgeprägten Hang zur Einsamkeit und zum stillen Gebet. Im Alter von 16 Jahren sah er in einer Vision einen hohen Turm an der
Stelle im Ranft, an der er später seine Einsiedelei errichtete. Berichtet wird auch vom Besuch dreier Männer - ähnlich dem Besuch der drei göttlichen Männer bei Abraham -,
die ihm seligen Tod verhießen und ihm ein Kreuz als Zeichen übergaben.
Nikolaus wurde Bauer und nahm ab 1440 als Offizier am Krieg gegen Zürich teil, in dem sich auch die "Bluttat von Greifensee" ereignete, die Ermordung der schon
besiegten Verteidiger. Wohl 1446 heiratete Nikolaus im Alter von etwa 29 Jahren die vierzehnjährige Dorothea Wyss, baute dann auf dem Flüeli ein neues Haus und wurde
Vater von fünf Knaben und fünf Mädchen. 1457
wandte er sich vor Gericht gegen die vom Pfarrer
von Sachseln geforderte Erhöhung der
Kirchensteuer, 1459 stieg er zum Ratsherrn in
Obwalden und Richter seiner Gemeinde auf. Man
achtete ihn wegen seines Gerechtigkeitssinnes und
seiner Klugheit; gegen höhere politische Aufgaben
wehrte er sich. 1460 war er nochmals als Soldat am
Feldzug gegen Thurgau beteiligt; der
Überlieferung zufolge verhinderte er dabei die
Brandschatzung des Klosters Katharinental in
Diessenhofen. Durch all die Jahre verließ ihn aber
nie die heimliche Sehnsucht nach dem
Einsiedlerleben. Als er seine Frau das erste Mal um
Entlassung bat, lehnte sie entsetzt ab.
Im Alter von 50 Jahren verschärfte sich seine
Suche nach dem Lebenssinn: "Schwer war ich
niedergedrückt. Lästig wurde mir meine liebste
Frau und die Gesllschaft der Kinder". Anfälle
plagten ihn, manchmal stand er mit verdrehten
Augen, offenem Mund und verzerrtem
Gesichtausdruck an die Wand gelehnt da und war
nicht mehr ansprechbar. Auf Anraten eines Priester
widmete er sich verstärkt der Betrachtung des
Leidens Christi; schließlich beschloss er - mit
ausdrücklichem Einverständnis seiner Frau und
der Kinder, was er als "große Gnade Gottes"
wertete -, ins Ausland zu gehen. Am Gallustag im
Oktober 1467 verließ Nikolaus seine Familie - das
jüngste Kind war gerade ein Jahr alt - und legte
alle politischen Ämter nieder. Er machte sich
zunächst den Weg zu einer mystischen
Bruderschaft in Basel, fühlte sich aber kurz vor dem
Erreichen seines Ziels durch drei Visionen in
Waldenburg zurückgerufen: mystische Gestalten
versperrten ihm den Weg, dann sah er die ganze
Stadt blutrot eingetaucht und in der folgenden
Nacht einen Lichtstrahl auf sich herabkommen, der
ihm Bauchschmerzen bereitete.
Nikolaus erkannte, dass seine Flucht nach Basel
nicht Gottes Willen entsprach; er traute sich aber
nicht, nach Hause zu kommen, und ging zunächst
auf die Alpe Chlisterli im Melchtal in einiger
Entfernung von seinem Heimatort.
Als er nach acht Tagen von Jägern gefunden wurde, begab Nikolaus sich schließlich doch an den Ort, den er seit Kindestagen in einer Vision als seine
Einsiedelei gesehen hatte: in die Ranftschlucht, nur wenige Minuten vom Wohnhaus seiner Familie auf dem Flüeli entfernt. In einer Hütte aus Ästen und Laub
verbrachte er dort den ersten Winter, im folgenden Sommer errichteten Bauern aus Flüeli in Fronarbeit die Zelle und Kapelle für Nikolaus, die der Konstanzer
Weihbischof 1469 - nach Prüfung der Ehrbarkeit von Nikolaus' Einsiedlerleben - zu Ehren der Mutter Gottes, der Büßerin Maria Magdalena, des heiligen
Kreuzes und der 10.000 Ritter konsekrierte.
1469 schloss sich der aus Memmingen stammende Priester Ulrich als Schüler Nikolaus an und errichtete eine Holzklause auf der gegenüberliegenden Seite des
Tales im Gebiet des heute St. Niklausen genannten Ortes an der Stelle der dann 1448 gebauten Kapelle im Mösli. Als auch er strengstens fastete und deshalb
krank wurde, mahnte Nikolaus ihn, davon abzulassen. Ulrich starb 1491.

Vatikan weist Deutsche Bischofskonferenz in ihre Schranken
Nach dem Missbrauchsskandal will sich die katholische Kirche in Deutschland reformieren. Doch jetzt funkt der Vatikan dazwischen – mit einer sehr klaren, fast spöttischen Botschaft.
Angeredet wird Reinhard Marx von seinem römischen Kardinalskollegen Marc Ouellet aus dem Vatikan gestelzt-höflich mit "Eure Eminenz". Aber dann hagelt es Kritik. Trefft keine deutschen Entscheidungen,
am Ende entscheidet Papst Franziskus, katholische Kirche ist keine Demokratie – mit so schroffen Feststellungen bügelt Rom den Wunsch in Deutschland nach mehr innerkirchlicher Offenheit ab. In dem
Gutachten lässt der Vatikan kaum ein gutes Haar am geplanten Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland.
Das ist der Konflikt
Worum geht es? Der sexuelle Missbrauch von Kindern
und Jugendlichen durch Kleriker hat das Vertrauen in die Kirche
erschüttert. Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) und
das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) – die Vertretung
der Gläubigen – sind sich deshalb einig: Jetzt muss
etwas geschehen. Sonst ist der Schaden irreparabel.
Deshalb wollen sie einen Reformprozess einleiten, den
"synodalen Weg". Es geht darin um vier Punkte: den Umgang der
Kirche mit Macht, die kirchliche Sexualmoral, die
umstrittene Ehelosigkeit von Priestern (Zölibat) und die Position
von Frauen in der Kirche. All diese Punkte haben nach
Expertenmeinung strukturell dazu beigetragen, dass der Missbrauch
über so lange Zeit ungestraft stattfinden konnte.
Erster Warnschuss kam vom Papst
Die große Frage zum geplanten Reformprozess ist:
Dürfen die deutschen Katholiken sowas überhaupt? Schließlich sind
sie nur ein Teil der viel größeren Weltkirche, und an
deren Spitze steht der Papst. Einen ersten Warnschuss aus Rom
gab's schon im Sommer: Da warnte Papst Franziskus die
deutschen Glaubensbrüder und -schwestern in einem Brief vor
Alleingängen. Weil er seine Aussagen aber in eine
blumig theologische Betrachtung verpackte, blieb alles so unscharf,
dass der DBK-Vorsitzende Reinhard Marx das Schreiben
sogar als "Ermutigung" werten konnte.
Das jetzt veröffentlichte Schreiben des Vatikans lässt
dagegen keinen Spielraum mehr für Interpretationen. Die deutsche
Teilkirche könne nicht über Themen wie die Position
der Frauen entscheiden, weil diese die ganze Weltkirche beträfen,
heißt es darin klipp und klar. Und die Nicht-Kleriker
vom ZdK haben demnach schon mal gar kein Recht,
mitzuentscheiden – schließlich sei die Kirche "nicht (...)
demokratisch strukturiert".
Woelki warnt vor Abspaltung
Der Kirchenrechtsexperte Thomas Schüller ist in seiner
Bewertung eindeutig: "Der 'synodale Prozess' kann damit nicht wie
geplant durchgeführt werden", folgert er. "Eine kleine
Minderheit der Bischöfe unter Führung von Kardinal Woelki hat es –
durch gute Kontakte nach Rom – geschafft, den ganzen
Reformprozess zu konterkarieren." Der in Kirchenfragen
erzkonservative Rainer Maria Woelki aus Köln hatte
kürzlich sogar gewarnt, es drohe eine Abspaltung der deutschen
Katholiken von der Weltkirche, wenn der Reformprozess
weitergehe.
ZdK-Präsident Thomas Sternberg zeigt sich dagegen entschlossen, den "synodalen Weg" weiterzugehen. Er sieht das Schreiben offenbar als Einschüchterungsversuch, von dem er sich aber nicht
beeindrucken lassen will: "Glaubt irgendjemand, man könne in einer solchen Krise der Kirche das freie Gespräch, das nach Ergebnissen und notwendigen Reformschritten sucht, unterdrücken?"
Böser Brief aus Rom

Franziskus von Assisi
«Il Cantico di Frate Sole» heisst das wunderbare Lied des Italieners
Francesco, «Der Gesang von Bruder Sonne». Ein poetischer Beitrag zur
Klimadebatte.
«Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein ist das Lob, die Herrlichkeit und Ehre
und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie und kein Mensch ist
würdig, dich zu nennen.» So beginnt sein Gesang, der Lob-gesang des Franziskus,
geschrieben im 13.
Jahrhundert.
Sonne und Mond
werden
darin zu seinen
Geschwistern,
zusammen
mit allem, was
ist. Als
wäre der Mensch
einzig und
alleine auf dieser
Welt, zu
staunen, zu beob-
achten und
sich zu freuen,
singt er
Gott und allem
Lebendigen
ein Lied. «Gelobt
seist du,
mein Herr, für
unsere
Schwester Mutter
Erde, die
uns erhält und
lenkt und
vielfäl-tige Früchte
hervorbringt, mit
bunten
Blumen und
Kräutern.»
Franziskus weiss,
dass er
alles
Lebensnotwen-dige geschenkt bekommt. Nehmen und besitzen wäre Zerstörung. Ist das
gemeint, wenn der Heilige weiter singt «Wehe jenen, die in töd-licher Sünde sterben»?
Franziskus hatte den prunkvollen Mantel seines Vaters eingetauscht gegen eine ein-fache
braune Kutte, er lebte mit der Natur und fand seinen persönlichen Einklang mit ihr.
«Selig, die Gott finden wird in seinem heiligsten Willen.»
von Veronika Jehle